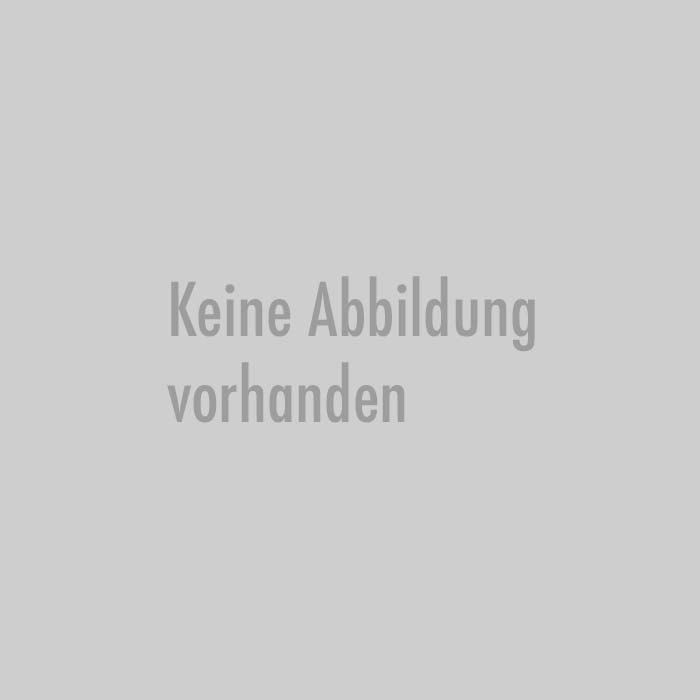
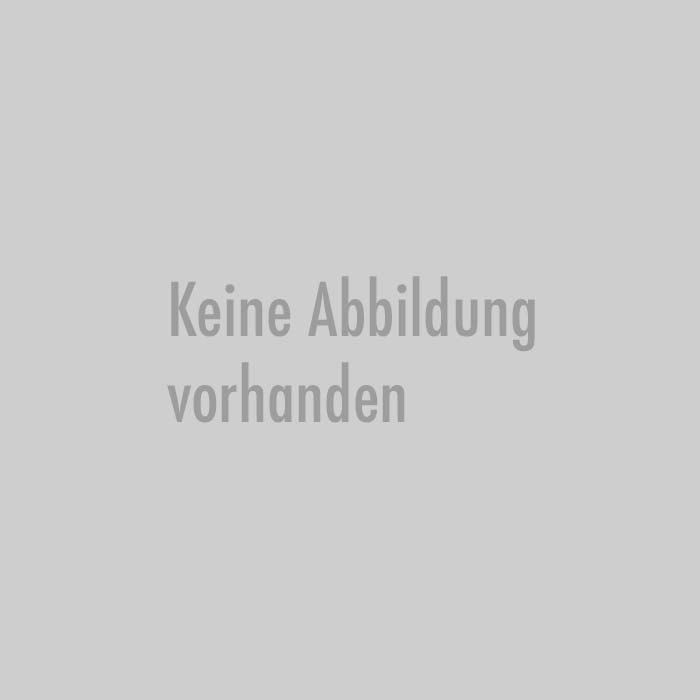
1/1
Miniaturspieltisch
Titel (alternativ):
Lombertisch
Objektkategorie:
Möbelminiatur
Künstler*in:
Johann Friedrich, Anhalt-Zerbst, Fürst (1695-1742)
GND Explorer
Herstellung:
Gotha
Entstehungszeit:
um 1705 - 1715
Abmessungen:
Höhe: 6,6 cm, Länge: 11,0 cm (gesamt)
Material:
Elfenbein (Elefant)
Technik:
geschnitzt
Beschreibung:
Sog. Lombertisch: dreiseitiger Spieltisch für das im 17. und 18. Jahrhundert sehr beliebte Kartenspiel Lomber (eigentlich L'hombre) für drei Spieler. Die Eckeinsätze sind für die Kerzenständer gedacht, die Vertiefungen für die Spielmarken bzw. das Geld, um das gespielt wird.
Inventarnummer:
K68
Schlagwort:
Kunstkammer Gotha
Standort:
Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, Depot
Projekt:
imdas
Weitere Objektinformationen
weitere Objektnummer:
Inventar 1717: fol. 62v-63r
Inventar 1764: fol. 70v, Nr. 55
Inventar 1830: fol. 11v, Nr. 103-109
Inventar 1858-Kunstkabinett: Band 1, fol. 290r, Nr. 210-216
Objekttext:
Zocken im Kleinformat
Das ebenso wie die drei Stühlchen von Prinz (später Fürst) Johann Friedrich von Anhalt-Zerbst gedrechselte und geschnitzte Tischchen wurde ursprünglich noch durch Spielzubehör - Teller, Karten, Marken („Tantes“) und Leuchter - komplettiert. Das Tischchen steht wie die Stühle auf einem spiralförmig gedrechselten Fuß und ist mit weiteren fein geschnitzten Rankenornamenten und Rosetten versehen.
Die ungewöhnliche Dreiecksform erklärt sich durch die Art des Kartenspiels, das an solchen Tischen gespielt wurde: nämlich dem im 17. und frühen 18. Jahrhundert sehr populären Lomber, das genau drei Spieler voraussetzte. Der Name Lomber leitet sich ab vom spanischen hombre (= Mann, d.h. Spieler), und tatsächlich soll das Spiel seinen Ursprung im Spanien des 14. Jahrhunderts haben. Entsprechende Tische hießen Lombertische, deren besondere Merkmale die drei Beutel oder Vertiefungen für die Marken bzw. Münzen, um die gespielt wurde, sowie die drei Eckeinsätze zum Aufstellen der Kerzenhalter waren.
Einer der Eckeinsätze muss bereits im frühen 19. Jahrhundert gefehlt haben, wie eine Anmerkung im letzten Kunstkammerinventar erkennen lässt, wurde aber kürzlich restauratorisch ergänzt.
Agnes Strehlau
Das ebenso wie die drei Stühlchen von Prinz (später Fürst) Johann Friedrich von Anhalt-Zerbst gedrechselte und geschnitzte Tischchen wurde ursprünglich noch durch Spielzubehör - Teller, Karten, Marken („Tantes“) und Leuchter - komplettiert. Das Tischchen steht wie die Stühle auf einem spiralförmig gedrechselten Fuß und ist mit weiteren fein geschnitzten Rankenornamenten und Rosetten versehen.
Die ungewöhnliche Dreiecksform erklärt sich durch die Art des Kartenspiels, das an solchen Tischen gespielt wurde: nämlich dem im 17. und frühen 18. Jahrhundert sehr populären Lomber, das genau drei Spieler voraussetzte. Der Name Lomber leitet sich ab vom spanischen hombre (= Mann, d.h. Spieler), und tatsächlich soll das Spiel seinen Ursprung im Spanien des 14. Jahrhunderts haben. Entsprechende Tische hießen Lombertische, deren besondere Merkmale die drei Beutel oder Vertiefungen für die Marken bzw. Münzen, um die gespielt wurde, sowie die drei Eckeinsätze zum Aufstellen der Kerzenhalter waren.
Einer der Eckeinsätze muss bereits im frühen 19. Jahrhundert gefehlt haben, wie eine Anmerkung im letzten Kunstkammerinventar erkennen lässt, wurde aber kürzlich restauratorisch ergänzt.
Agnes Strehlau
Bibliographie (in Auswahl)
Literatur:
Dettmann, Ingrid; Strehlau, Agnes: Die herzogliche Kunstkammer in Gotha, Bd. 1 und 2; Petersberg: Imhof, 2021, S. 174, 291 (Bd. 1); 39 (Bd. 2), Abb. I.85a, Nr. I.85a
Trümper, Timo: Wieder zurück in Gotha! : Die verlorenen Meisterwerke; Petersberg: Imhof, 2021, S. 119/262 Seiten, Nr. 6
Zugriff und Nutzungsmöglichkeiten
IIIF-Manifest:
Polygon GeoJSON:
{"type":"FeatureCollection","features": [{"type":"Feature","properties": {},"geometry": {"type":"Point","coordinates": [10.701666,50.948055]}}]}
Kontaktinformationen
Stiftung Schloss Friedenstein Gotha
Schlossplatz 1
99867 Gotha
+49 3621 8234-100
sekretariat(at)stiftung-friedenstein.de
Schlossplatz 1
99867 Gotha
+49 3621 8234-100
sekretariat(at)stiftung-friedenstein.de
Administrative Angaben
In Portal übernommen am:
2024-01-25T15:29:43Z
Feedback
Unsere Datensätze befinden sich in stetiger Weiterentwicklung. Wenn Sie zusätzliche Informationen zu diesem Objekt oder einen Fehler entdeckt haben, dann schreiben Sie uns. Informationen zum Datenschutz
Ähnliche Objekte(1076):
Die Gottheit des langen Lebens Shouxing und die acht daoistischen Unsterblichen auf separatem Sockel
Stiftung Schloss Friedenstein Gotha
|
Möbelminiatur
|
um 1705 - 1715
|
Johann Friedrich, Anhalt-Zerbst, Fürst (1695-1742)
Stiftung Schloss Friedenstein Gotha
|
Möbelminiatur
|
um 1705 - 1715
|
Johann Friedrich, Anhalt-Zerbst, Fürst (1695-1742)
Ähnliche Objekte
Entdecken Sie ähnliche Objekte. Über die Datenfelder können Sie die Objekte auswählen, die Sie interessieren. Sie können Ihre Suchfilter beibehalten oder deaktivieren.
Suchfilter berücksichtigen
-
Objektkategorie:
- 1
-
Datenquelle:
- 1